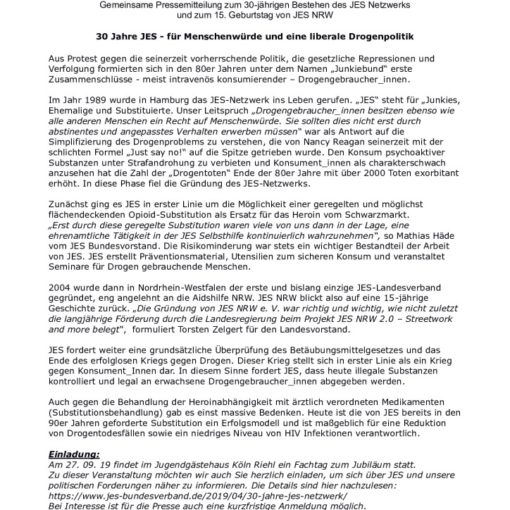Drogenpolitik der Bundesregierung gefährdet Menschenleben, warnen Experten. Internationaler Gedenktag für verstorbene Konsumenten am Sonntag
Seit Jahren fordern Suchtmediziner, Angehörige von Drogengebrauchern und Betroffene ein Umdenken in der herrschenden Drogenpolitik. Warum die nötig wäre, zeigen aktuelle Zahlen: Alleine im letzten Jahr starben in der Bundesrepublik 1.276 Menschen an den Folgen des Konsums illegalisierter Stoffe. 191 Menschen – und damit satte 14 Prozent mehr als im Vorjahr – kamen 2018 alleine in Berlin ums Leben. Jeder Todesfall kann auch als Anklage gegenüber der bislang betriebenen Kriminalisierung, Ausgrenzung und unterlassenen Hilfeleistung von Konsumenten verstanden werden.
Erst im Juni hatte die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) ihren jährlich erscheinenden Bericht mit aktuellen Daten vorgestellt. Darin heißt es, schätzungsweise rund 96 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger im Alter zwischen 15 und 64 Jahren hätten mindestens einmal in ihrem Leben illegalisierte Drogen genommen. Allein im letzten Jahr sollen der EBDD zufolge geschätzt 19,1 Millionen der 15- bis 34jährigen (16 Prozent) verbotene Stoffe konsumiert haben. Im Jahr 2017 wurden in der EU schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen wegen des Drogengebrauchs behandelt.
Neben dem Konsum von Cannabis steigt aktuell vor allem der von Kokain an. Das zeige sich sowohl anhand der Zahl der einzelnen Sicherstellungen als auch anhand der dabei gefundenen Mengen. Letztere befänden sich laut EBDD »auf einem Rekordhoch«. Mittlerweile sprechen sich selbst Polizeibedienstete dafür aus, den Besitz kleinerer Mengen von Kokain zum Eigenbedarf nicht mehr unter Strafe zu stellen. So hatte Olaf Schremm, Chef der Drogenfahndung im Landeskriminalamt Berlin, Ende Juni gegenüber dem Tagesspiegel dazu aufgerufen, »einen neuen Umgang mit Kleinstmengen Kokain« zu finden. So könnten etwa Eigenbedarfsregelungen auch für sogenannte harte Drogen eingeführt werden (jW berichtete).
Während der Kokainkonsum in allen gesellschaftlichen Schichten ansteigt und Debatten neue Wendungen nehmen, sieht es beim Thema Heroin nach wie vor düster aus. Die Mehrheit der Gebraucher sogenannter harter Drogen verstirbt nicht an dem Stoff selbst. Vielmehr sind mögliche Verunreinigungen, Überdosierungen, äußere Umstände des Konsums, staatliche Repression und mangelnde Hilfsangebote wie etwa öffentliche Drogenkonsumräume der Grund dafür, dass viele Menschen dem Kreislauf der Sucht nicht entkommen können und schlimmstenfalls ihr Leben lassen.
Um auf die Situation der Konsumenten illegalisierter Stoffe aufmerksam zu machen, aber auch der Verstorbenen zu gedenken, finden traditionell am 21. Juli, dem »Internationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher«, in vielen bundesdeutschen Städten Kundgebungen und Mahnwachen statt. Der besagte Gedenktag geht auf den Tod des jungen Drogengebrauchers Ingo Marten zurück, der am 21. Juli 1994 in Gladbeck verstarb. Seiner Mutter gelang es, mit Unterstützung der Stadt eine Gedenkstätte für ihren Sohn und andere verstorbene Konsumenten zu installieren. In den nächsten Jahren folgten weitere Orte der Erinnerung und Mahnung in anderen Städten. Bundesweit steht der Gedenktag in diesem Jahr unter dem Motto »Gesundheit und Überleben gibt es nicht zum Nulltarif«.
»Mit diesem Thema fokussieren wir auf die stetige Ausdifferenzierung der Angebote kommunaler Suchthilfe«, erklärte Dirk Schaeffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH), am Donnerstag gegenüber jW. Ohne die entsprechenden kommunalen Mittel würden »dringend erforderliche und erfolgreiche Beratungs- und Testangebote für HIV und Hepatitis C nach dem Ende der Modellphase wieder eingestellt«. Es brauche den »Ausbau eines ausdifferenzierten Hilfesystems von niedrigschwelligen Angeboten« sowie neue Beratungsformate »für Konsumentinnen und Konsumenten von neuartigen psychoaktiven Substanzen«, forderte Schaeffer. Selbst dringend erforderliche Fortbildungsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Suchthilfe könnten vielfach nur im beschränkten Umfang stattfinden.
»Die kommunale Suchthilfe benötigt schon lange eine bessere finanzielle Ausstattung, um den aktuellen Anforderungen mit hoher fachlicher Qualität, hinreichend Zeit und angemessener Empathie begegnen zu können«, gab der DAH-Referent im jW-Gespräch zu bedenken. So ermögliche die Arbeit der Beratungsstellen vor Ort Drogengebrauchenden nicht nur eine unmittelbare Hilfe bei akuten Problemlagen. Dort würden sich zudem »auf positive Weise soziale Treffpunkte für ansonsten gesellschaftlich weitgehend ausgegrenzte Menschen« entwickeln, so Schaeffer, der sich auch im bundesweiten Netzwerk JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) engagiert. Dieser Zusammenschluss feiert mit einem Fachtag am 27. September in Köln sein 30jähriges Bestehen.
In der Domstadt wird der internationale Gedenktag unterdessen bereits am morgigen Sonnabend (12 bis 16 Uhr) auf dem Rudolfplatz begangen, um mehr Menschen als an einem Sonntag zu erreichen. Laut offiziellen Erhebungen stieg die Anzahl der Drogentoten in Köln von 51 (2017) auf 71 im Jahr 2018 – ein Zuwachs um annähernd 40 Prozent. Marco Jesse von Vision e. V., dem »Verein für innovative Drogenselbsthilfe« aus Köln, nannte in einer anlässlich des Gedenktages veröffentlichten Stellungnahme einige der Ursachen für diese negative Entwicklung: steigende Zahlen von Obdachlosen, das zunehmende Lebensalter der Konsumenten, die fehlende Möglichkeit, legal Drogen zu nehmen. Jesse warnte auch vor der zunehmenden Perspektivlosigkeit bei den Drogengebraucherinnen und -gebrauchern »aufgrund fehlender sinnstiftender Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten«.
Informationen und Hilfsangebote: jes-bundesverband.de, vision-ev.de, akzept.org, aidshilfe.de
(Quelle: junge.Welt / Markus Bernhardt)